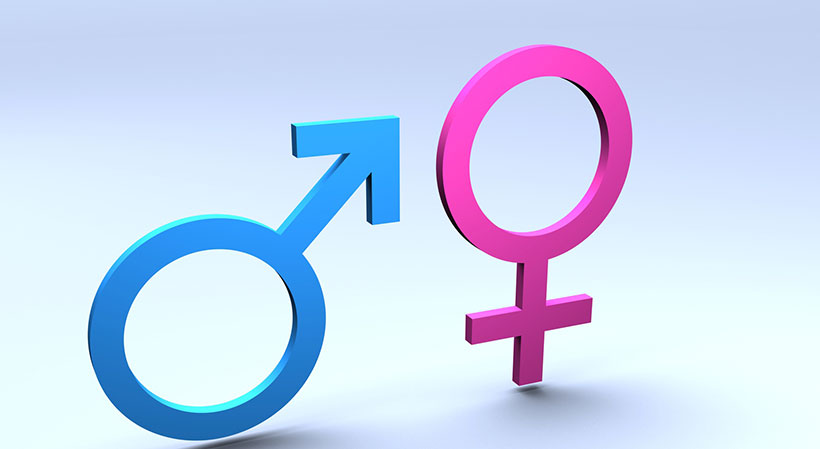
Gender-Medizin
Mehr als ein kleiner Unterschied
Frauen und Männer sind verschieden. Das weiß jeder. Aber dass die Unterschiede weit über die Gebärfähigkeit von Frauen hinaus gehen, wurde in der Medizin bis in die 1990er Jahre kaum beachtet. Neuere Untersuchungen haben allerdings gezeigt, dass das Auftreten, die Symptome und der Verlauf vieler Erkrankungen geschlechtsabhängig sind. Als Teil der personalisierten Medizin findet deswegen die sogenannte Gender-Medizin immer mehr Beachtung.
Gender-Medizin – was bedeutet das eigentlich?
Die menschliche Gesundheit wird von vielen Faktoren beeinflusst: Ernährung, Umwelteinflüsse, familiäre Vorbelastung sind nur einige Beispiele. Durch Untersuchungen weiß man inzwischen, dass für das Auftreten, die Diagnose, die Therapie und den Verlauf vieler Erkrankungen sowohl das biologische Geschlecht (engl.: sex) „Frau“ oder „Mann“ als auch das soziale Geschlecht (engl.: gender) eine ausschlaggebende Rolle spielen. Mit dem sozialen Geschlecht bezeichnet man die gesellschaftlich und kulturell geprägten Rollen von Frauen und Männern und ihre Aufgaben und ihr Verhalten im Lebensalltag.
Die Gender-Medizin befasst sich damit, welche Auswirkungen „Sex“ und „Gender“ auf Erkrankungen haben und wie man die gesundheitliche Versorgung von Frauen und Männern anpassen und verbessern kann.
Das biologische Geschlecht
Der männliche und der weibliche Körper unterscheiden sich durch Körperbau und -größe, aber auch innerlich z. B. durch die Größe und Funktionsweise der Organe, die Dicke der Gefäße oder die Dichte der Knochen. Auch der Hormonhaushalt ist bei Männern und Frauen sehr unterschiedlich. So verwundert es nicht, dass männliche und weibliche Körper Unterschiede in der Aufnahme von Wirkstoffen und in den Reaktionen des Körpers auf eben diese Wirkstoffe aufweisen.
Dennoch wurde der männliche Körper lange Zeit als Norm angesehen, und Medikamententests wurden mit männlichen Probanden durchgeführt. Die Idee war, dass die Ergebnisse hier nicht durch zyklusbedingte, hormonelle Unterschiede verzerrt würden. Die Testergebnisse wurden dann auf Frauen übertragen. Studien zeigen allerdings, dass es viele Erkrankungen gibt, die bei gleicher Therapie bei Männern und Frauen unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Der unterschiedliche Stoffwechsel kann z. B. zu Über- oder Unterdosierung von Wirkstoffen führen, im schlimmsten Fall mit schwerwiegenden Folgen.
Das soziale Geschlecht
Wie wächst ein Mensch auf, welche Erfahrungen hat er gemacht, in welcher emotionalen Situation befindet er sich, in welcher Lebensphase? All diese Aspekte beeinflussen die Wahrnehmung des eigenen Körpers, die Kommunikationsfähigkeit des Menschen und den Umgang mit Problemen. Sie sind ausschlaggebend für die Entscheidung eines Menschen, einen Arzt aufzusuchen, für die Diagnosestellung, die Therapie und den Erholungsprozess nach einer Krankheit.
Aber auch hier scheint es einen Geschlechterunterschied in der Körperwahrnehmung und der Interpretation von Körperfunktionen zu geben. Man spricht vom sozialen Geschlecht: Es umfasst Faktoren wie z. B. Familienstrukturen, Erziehung, soziale Beziehungen, Sozialsystem, Ernährung, körperliche Aktivität oder erlebte Traumata.
Untersuchungen zufolge suchen z. B. Frauen eher einen Arzt auf und kommunizieren ihre Probleme. Männer suchen tendenziell eher erst nach eigenen Lösungsansätzen oder kommunizieren manchmal nur einen gewissen Teil ihrer Probleme.
Der Umgang mit Diagnosen scheint ebenfalls geschlechterabhängig zu sein, vom Schmerzempfinden bis hin zur Arzt-Patienten-Kommunikation: Auch hier ticken Frauen und Männer anders. Und genau dieses Anderssein kann sich schon auf die Untersuchung und die Diagnosestellung des Arztes auswirken und ausschlaggebend für eine weitere Therapie sein.
Ärztin oder Arzt?
Nicht nur das Geschlecht der Patienten, auch das Geschlecht des medizinischen Fachpersonals nimmt anscheinend Einfluss auf die medizinische Versorgung. Dies betrifft z. B. die Kommunikation zwischen Patientin / Patient auf der einen Seite und Ärztin / Arzt auf der anderen Seite. Welche gesundheitlichen Probleme spricht eine Patientin bei ihrem Arzt an, welche bei ihrer Ärztin? Dasselbe gilt für den Patienten. Je intimer die Probleme werden, desto mehr Hemmschwellen scheinen zu existieren, oftmals sind diese unbewusst.
Diesen geschlechtsbezogenen Verzerrungs-Effekt gibt es aber nicht nur auf Seiten der Patienten. Wie Untersuchungen zeigen, scheinen Ärzte und Ärztinnen bei gleichen Symptomen des Patienten / der Patientin unterschiedliche Untersuchungen vorzunehmen und unterschiedliche Therapie-Entscheidungen zu treffen. Geschlechterspezifische Lebensphasen können zusätzlich die Behandlung beeinflussen: So verschreiben niederländischen Untersuchungen zufolge z. B. Hausärztinnen mit menopausalen Beschwerden Patientinnen in den Wechseljahren öfter hormonelle Ersatztherapien, als es jüngere Hausärztinnen oder männliche Kollegen tun.
Dies alles zeigt, wie wichtig ein vertrauensvolles Arzt-Patienten-Verhältnis auf Augenhöhe ist. Ein selbstreflektiertes Handeln auf beiden Seiten kann helfen, eine optimale Behandlung zu gewährleisten.
Ein Beispiel aus der Praxis
Bei einigen Erkrankungen ist eine differenzierte, geschlechtsabhängige Betrachtung überlebenswichtig, wie ein Beispiel aus der Kardiologie zeigt: Ein Mann klagt über Engegefühl in der Brust und über in den Arm ausstrahlende Schmerzen. Eine Frau klagt über schmerzende Kiefergelenke, Schweißausbrüche, Kurzatmigkeit. So unterschiedlich die Symptome sind, so gleich kann doch die Diagnose sein: Herzinfarkt. Wichtig ist jetzt eine schnelle Therapie. Leider wird die Diagnose „Herzinfarkt“ bei Frauen oft erst spät gestellt, da der Herzinfarkt immer noch als klassische „Männerkrankheit“ angesehen wird und die Symptome der Frau „unspezifisch“ erscheinen. So werden Frauen mit akutem Infarkt ca. 40 Minuten später ins Krankenhaus eingeliefert.
Statistische Daten belegen, dass mehr Frauen als Männer infolge einer Herz/Kreislauf-Erkrankung sterben. Allein dieses Bespiel zeigt die Wichtigkeit der Gender-Medizin. Aber auch HIV bei Frauen oder Osteoporose bei Männern werden durch stereotype Zuordnungen oft übersehen oder erst spät erkannt und eine entsprechende Behandlung so verhindert.
Für die Zukunft
Wichtig ist, dass die Gender-Medizin Einzug in die Arztpraxen, die Notfallversorgung und die Krankenhäuser hält. Dass Medizinstudenten schon im Studium für die Gender-Medizin sensibilisiert werden und dass ein Umdenken in der wissenschaftlich-medizinischen Forschung stattfindet. Wir brauchen einen offenen Umgang mit dieser Thematik.
Und natürlich müssen auch Patientinnen und Patienten sensibilisiert werden. Denn wie das Beispiel aus der Kardiologie zeigt: Gender-Medizin kann überlebenswichtig sein.
Bildquelle: © lunizbln, fotolia.com

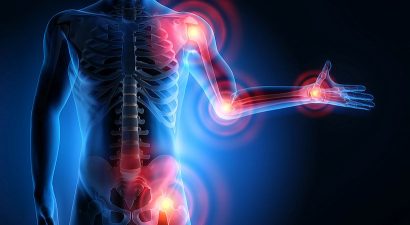 Frauen und Rheuma
Frauen und Rheuma